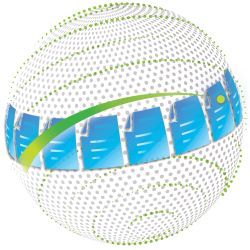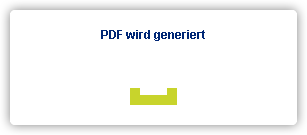FG München: Teilwert einer verdeckten Einlage durch Forderungsverzicht bei negativem Eigenkapital
Ein durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasster Forderungsverzicht eines Gesellschafters gegenüber seiner Gesellschaft führt bei dieser zu einer verdeckten Einlage in Höhe des Teilwerts der Forderung. Zur Ermittlung des Teilwerts der erlassenen Forderung ist bei negativem Eigenkapital zu prüfen, ob stille Reserven vorhanden sind, die die latente Überschuldung so weit beseitigen, dass die Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch ihr Vermögen gedeckt sind. Ist das auf diese Weise ermittelte Eigenkapital positiv, entspricht der Teilwert der Darlehensforderung ihrem Nennwert.
Sachverhalt
Eine GmbH erklärte für das Jahr 2013 in ihrer Körperschaftsteuererklärung einen Jahresfehlbetrag und löste eine Darlehensverbindlichkeit, für welche ein Gesellschafter einen auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Darlehensverzicht aussprach, durch den außerbilanziellen Abzug einer verdeckten Einlage erfolgsneutral auf. Das Finanzamt war der Auffassung, dass die Darlehensverbindlichkeit teilweise erfolgswirksam aufzulösen und das erklärte Jahresergebnis entsprechend zu erhöhen sei. Es schätzte den Teilwert der erlassenen Forderung dabei auf einen unter dem Nennwert liegenden Wert.
Entscheidung
Das FG kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass der Teilwert der erlassenen Forderung ihrem Nennwert entspricht und der durch den Forderungsverzicht entstandene Gewinn daher außerbilanziell in voller Höhe zu neutralisieren ist.
Bilanzierung einer verdeckten Einlage in Form eines Forderungsverzichts
Eine verdeckte Einlage in Form eines Forderungsverzichts gegenüber der Gesellschaft führt durch den Wegfall der zuvor passivierten Verbindlichkeiten bei der Kapitalgesellschaft zu einer Vermögensmehrung, die nach handelsrechtlichen Grundsätzen als Gewinn auszuweisen ist. Dem ist steuerrechtlich jedoch durch den Abzug einer verdeckten Einlage gemäß § 8 Abs. 3 S. 3 KStG außerhalb der Bilanz zu begegnen, wenn der Gesellschafter den Erlass im Hinblick auf das Gesellschaftsverhältnis gewährt hat (vgl. BFH-Beschluss vom 09.06.1997, GrS 1/94). Erstreckt sich der Verzicht des Gesellschafters auf eine nicht als vollwertig angesehene Forderung, hat die Gesellschaft als Wert der Einlage den tatsächlichen Wert der Forderung, nicht ihren Nennbetrag und auch nicht den als Verbindlichkeit passivierten Betrag anzusetzen.
Bewertung einer verdeckten Einlage in Form eines Forderungsverzichts
Gemäß §§ 8 Abs. 1 S. 1 KStG, 7 S.1 GewStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 Hs. 1 EStG ist die Einlage bei der Kapitalgesellschaft mit dem Teilwert der Forderung, auf die verzichtet wurde, im Zeitpunkt der Zuführung zu bewerten. Soweit die Forderung im Zeitpunkt des Verzichts nicht (mehr) werthaltig war, bleibt es bei der durch den Wegfall der Verbindlichkeit ausgelösten Gewinnerhöhung (vgl. BFH-Beschluss vom 09.06.1997, GrS 1/94). Diese Grundsätze gelten auch im Fall eines Darlehensverzichtes mit eigenkapitalersetzendem Charakter (vgl. BFH-Urteil vom 28.11.2001, I R 30/01; BFH-Beschluss vom 16.05.2001, I B 143/00).
Grundsätze zur Ermittlung des Teilwerts einer vom Gesellschafter erlassenen Forderung
Für die Ermittlung des Teilwerts der vom Gesellschafter erlassenen Forderung ist auf den Wert abzustellen, den die Gesellschaft als Betriebsinhaberin für den Erwerb der Forderung oder die Herbeiführung des Verzichts hätte aufwenden müssen (vgl. BFH-Beschluss vom 09.06.1997). Der Teilwert einer Darlehensforderung ist im Wege der Schätzung aufgrund der am Bilanzstichtag gegebenen objektiven Verhältnisse zu ermitteln und wird durch die Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des Schuldners und durch ihre Verzinslichkeit beeinflusst. Maßgebend ist, ob nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufgrund der Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des Schuldners mit einem (teilweisen) Forderungsausfall zu rechnen ist (vgl. BFH-Urteil vom 20.08.2003, I R 49/02; FG Hamburg, Urteil vom 12.02.2014, 6 K 203/11).
Ermittlung des Teilwerts einer vom Gesellschafter erlassenen Forderung bei negativem Eigenkapital
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze war die erlassene Forderung nach Auffassung des FG in voller Höhe werthaltig. Zwar war das Eigenkapital der Gesellschaft negativ, jedoch seien stille Reserven vorhanden, die die latente Überschuldung so weit beseitigen, dass die Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch ihr Vermögen gedeckt sind. Ist das auf diese Weise ermittelte Eigenkapital positiv, entspreche der Teilwert der Darlehensforderung ihrem Nennwert, denn bei positivem Eigenkapital könne regelmäßig von einer „wirtschaftlich gesunden Kapitalgesellschaft“ und damit von einer ausreichenden Bonität ausgegangen werden.
Der Teilwert der erlassenen Forderung entspricht ihrem Nennwert
Im Streitfall war die Gesellschafterforderung unter Berücksichtigung der stillen Reserven durch das Aktivvermögen der Gesellschaft abgedeckt, sodass nach Ansicht des FG kein Grund für die Annahme eines niedrigeren Teilwerts bestand. Der durch den Forderungsverzicht entstandene Gewinn war folglich außerbilanziell in voller Höhe zu neutralisieren, da der Teilwert der erlassenen Forderung ihrem Nennwert entsprach.
Betroffene Norm
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1 Hs. 1 EStG
Streitjahr 2013
Fundstelle
Finanzgericht München, Urteil vom 09.04.2018, 7 K 729/17, EFG 2018, S. 1126, rechtskräftig
Weitere Fundstellen
FG Hamburg, Urteil vom 12.02.2014 6 K 203/11
BFH, Urteil vom 20.08.2003, I R 49/02, BStBl II 2003, S. 941
BFH, Urteil vom 28.11.2001, I R 30/01, BFH/NV 2002, S. 677
BFH, Beschluss vom 16.05.2001, I B 143/00, BStBl II 2002, S. 436
BFH, Beschluss vom 09.06.1997, GrS 1/94, BStBl II 1998, S. 307