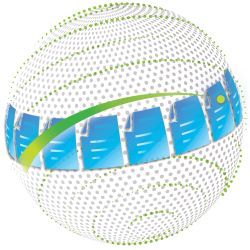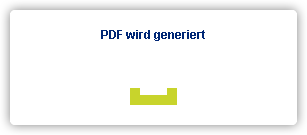BFH: Passiver RAP bei zeitlich nicht begrenzter Verpflichtung
Die für die Bildung eines passiven RAP erforderliche bestimmte Zeit kann, wenn eine zeitlich unbegrenzte Dauerleistung geschuldet wird, auch eine immerwährende Zeit sein. Es ist dann eine Verteilung der Einnahmen auf 25 Jahre vorzunehmen.
Sachverhalt
Für die Vereinbarung einer dauerhaften Verpflichtung (Unterlassen der Erweiterung der Schweinehaltung) erhielt der Kläger von einem Zweckverband eine Entschädigungszahlung und bildete hierfür im Wirtschaftsjahr 2005/2006 einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP). Das FG erkannte die Bildung eines passiven RAP an und ging von einer Auflösung über einen Zeitraum von insgesamt 15 Jahren aus.
Entscheidung
Das FG habe zurecht entschieden, dass der Kläger verpflichtet war, einen passiven RAP zu bilden. Dieser sei allerdings nicht über einen Zeitraum von 15 Jahren, sondern von 25 Jahren aufzulösen.
Als passiver RAP sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt darstellen (§ 250 Abs. 2 HGB, § 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG). Hierunter fallen hauptsächlich typische Vorleistungen eines Vertragspartners im Rahmen eines gegenseitigen Vertrags.
Die Bildung eines passiven RAP sei nicht nur bei Bar- oder Buchgeldzahlungen, sondern wie im Streitfall auch bei einer als Ertrag gebuchten Forderung gerechtfertigt. Weiterhin könne nach der Rechtsprechung die vom Steuerpflichtigen zu erbringende Gegenleistung auch in einem Unterlassen bestehen.
Als „bestimmte Zeit“ i.S.v. § 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG sei grundsätzlich ein kalendermäßig festgelegter oder berechenbarer Zeitraum anzusehen. Darüber hinaus könne nach der Rechtsprechung des BFH auch eine immerwährende Zeit eine bestimmte Zeit sein, wenn der Steuerpflichtige eine zeitlich nicht begrenzte Dauerleistung zu erbringen hat (vgl. BFH-Urteil vom 09.12.1993; ebenso BMF-Schreiben vom 15.03.1995). Auch eine immerwährende Zeit sei bestimmt, weil feststehe, dass sie niemals enden wird.
Unzutreffend sei die Annahme des FG, dass die Einnahme im Streitfall auf 15 Jahre zu verteilen sei.
Entgegen der Auffassung des FG könne nämlich nicht auf § 7 Abs. 1 S. 3 EStG, wonach als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts eines Gewerbebetriebs oder eines Betriebs der LuF ein Zeitraum von 15 Jahren gilt, zurückgegriffen werden. Denn diese Norm stehe mit der hier interessierenden Frage, welcher Anteil der Einnahme die nach dem Bilanzstichtag zu erbringende Gegenleistung (des Klägers) abgilt, in keinem Zusammenhang. Der BFH ist vielmehr der Auffassung, dass eine Verteilung der Einnahme auf 25 Jahre sachgerecht sei (im Ergebnis ebenso BFH-Urteil vom 09.12.1993).
Betroffene Normen
§ 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG, § 250 Abs. 2 HGB
Streitjahr 2005/2006
Anmerkung
Der BFH stellt in seinem Urteil lediglich fest, dass er im Falle einer immerwährenden Verpflichtung eine Auflösung des passiven RAP über einen Zeitraum von 25 Jahren für sachgerecht hält, begründet dies aber nicht weiter.
Vorinstanz
Finanzgericht Nürnberg, Urteil vom 19.09.2013, 4 K 1613/11, EFG 2014, S. 906
Fundstelle
BFH, Urteil vom 15.02.2017, VI R 96/13, BStBl II 2017 Seite 884
Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 09.12.1993, IV R 130/91, BStBl II 1995, S. 202
BMF, Schreiben vom 15.03.1995